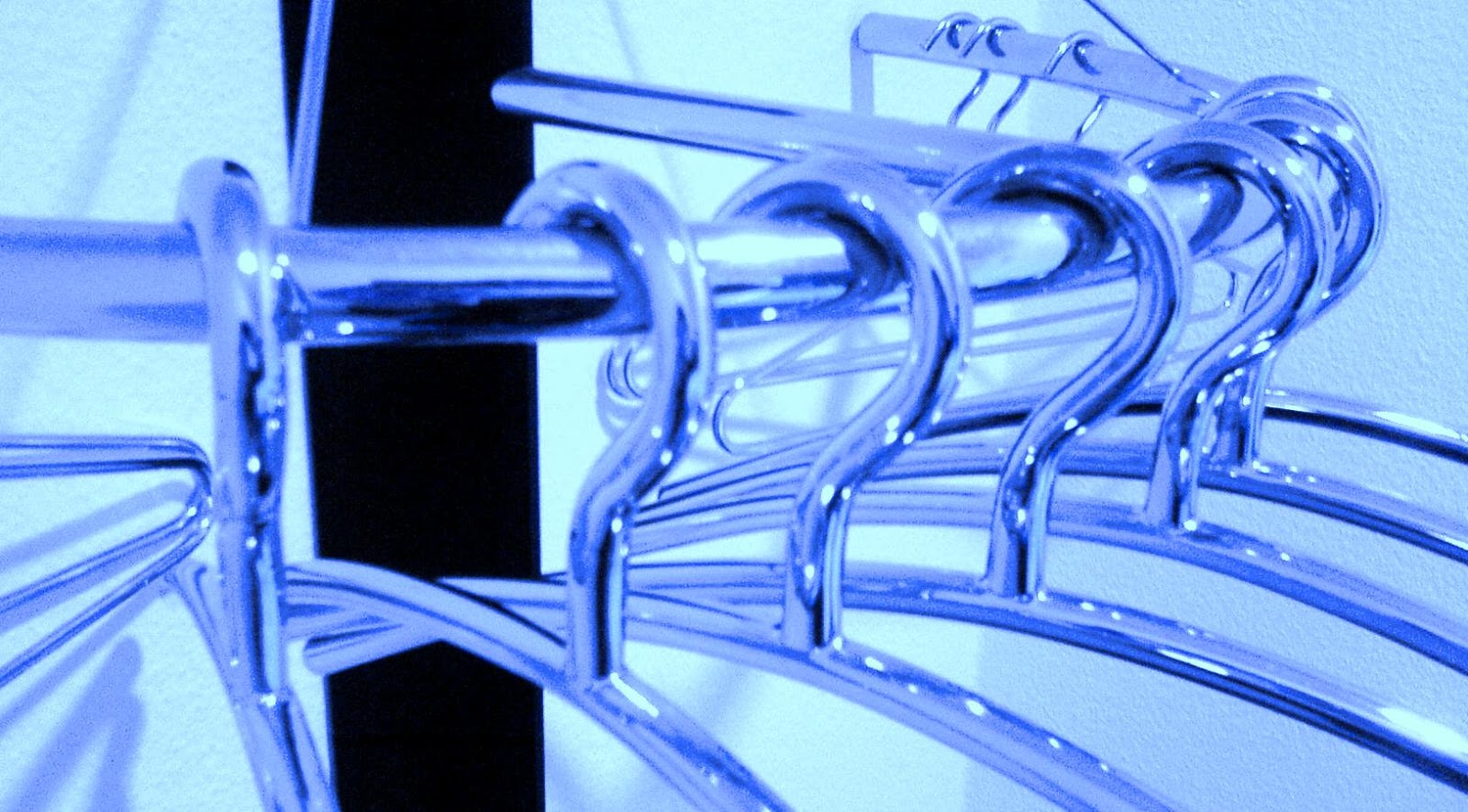|
| Da ist Musik drin...BGH zum Filesharing |
Heute hat
der BGH über drei Filesharing-Klagen verhandelt. Die in den drei Verfahren soeben ergangenen Entscheidungen dürften für viel Streit und Diskussionsstoff sorgen. Die Abwehr übermotivierter Filesharing-Abmahnungen und -Klagen wird nicht einfacher.
Klägerinnen
sind in allen drei Revisonsverfahren die vier führenden deutschen
"Tonträgerherstellerinnen" Warner,
Sony, Universal und EMI. Diese
berufen sich jeweils auf angeblich ordnungsgemäße Recherchen eines Crawling-Unternehmens,
wonach im Jahre 2007 über eine IP-Adresse jeweils mehrere hundert bzw. mehrere
tausend Musiktitel zum Herunterladen innerhalb eines P2P-Systems verfügbar
gemacht worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte mithilfe des
Internetserviceproviders die jeweiligen Beklagten als vermeintliche Inhaber des
der IP-Adresse zugewiesenen Internetanschlusses.
Die
Musikverlage verlangen von den Beklagten urheberrechtlichen Schadensersatz in
Höhe von mehreren tausend Euro sowie Ersatz von anwaltlichen Abmahnkosten in
ähnlicher Größenordnung.
................................................................................
1. Im BGH-Verfahren I ZR 75/14 hat der Beklagte die Richtigkeit der Ermittlungen des Recherche-Unternehmens
und die zeitgleiche Zuweisung der dynamischen IP-Adresse bestritten - ebenso
wie die angeblichen Uploads durch ihn, seine im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienangehörigen oder durch Dritte. Er sowie seine Ehefrau und seine beiden Söhnen hätten sich zur
angeblichen Tatzeit im Urlaub auf Mallorca befunden und vor dem Urlaubsantritt seien Router
und Computer vom Stromnetz getrennt worden, wobei allerdings nicht auszuschließen sei, dass einer der Familienangehörigen vor Abreise heimlich die Anlage wieder angestellt hat.
Das LG Köln hat mit Urteil vom 24.10.2012
(Az. 28 O 391/11) die Klage
abgewiesen.
Das OLG Köln hat den
Beklagten mit Urteil vom 14.03.2014 (Az. 6 U 210/12) nach Zeugenvernehmung eines Mitarbeiters des Crawling-Unternehmens
sowie der Familienangehörigen antragsgemäß verurteilt. Der OLG-Senat hat es als
erwiesen angesehen, dass die Musikdateien von dem Rechner des Beklagten zum
Herunterladen angeboten worden sind. Der Beklagte habe als Anschlussinhaber für
die Urheberrechtsverletzungen einzustehen, weil nach seinem eigenen Vortrag ein
anderer Täter nicht ernsthaft in Betracht komme. Das Bestreiten seiner Verantwortlichkeit stelle sich "als denklogisch fernliegend und daher prozessual nicht erheblich dar."
................................................................................
2. Im BGH-Verfahren I ZR 7/14 wurde der
Internetanschluss von der Beklagten, ihrem 16jährigen Sohn und ihrer 14jährigen
Tochter genutzt. Gegenüber der Polizei hatte die Tochter zugegeben, "die
Musikdateien heruntergeladen zu haben". Auf die anwaltliche Abmahnung
reagierte die Mutter mit der Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung.
Die Beklagte
wendet sich zivilgerichtlichen Klageverfahren gegen die Verwertung des
polizeilichen Geständnisses ihrer Tochter. Zudem trägt sie vor, ihre Tochter
über die Rechtswidrigkeit der Teilnahme an Musiktauschbörsen belehrt zu haben.
Das LG Köln hat mit Urteil vom 02.05.2013 (Az.
14 O 277/12) nach der Zeugenvernehmung
der Tochter der Klage überwiegend stattgegeben.
Das OLG Köln hat diese Entscheidung mit Berufungsurteil vom 06.12.2013
(Az. 6 U 96/13) im Wesentlichen bestätigt..
Das OLG hält die Täterschaft der Tochter für erwiesen und wirft der Mutter die Verletzung
ihrer Aufsichtspflicht vor.
................................................................................
3. Im BGH-Verfahren I ZR 19/14 liegt
der Fall so, dass der Internetserviceprovider als angeblichen Inhaber der
IP-Adresse eine Person angegeben hatte, die in einem Buchstaben von dem
Familiennamen des Beklagten abwich und ansonsten mit seinem Vor- und Nachnamen
und seiner Anschrift übereinstimmte.
Nach
anwaltlicher Filesharing-Abmahnung gab der Beklagte, ein selbständiger IT-Berater, ohne Rechtsanerkenntnis eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und wies gleichzeitig die geltend
gemachten Zahlungsansprüche zurück. Er bestreitet die Richtigkeit der
Recherchen des Crawling-Unternehmens und die per Excel-Tabelle übermittelten Angaben des Internetserviceproviders
sowie seine und die Täterschaft eines in gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienangehörigen. Der im
Arbeitszimmer des Beklagten installierte PC war zur fraglichen Zeit
unstreitig eingeschaltet und mit dem Internet verbunden. Die beim Beklagten angestellte
und den Computer insoweit ebenfalls beruflich nutzende Ehefrau verfügte nicht
über ausreichende Administratorenrechte zum Aufspielen von Programmen. Dem
damals im Haushalt des Beklagten lebenden, seinerzeit 17 Jahre alten Sohn war das
Rechner-Passwort unbekannt.
Das LG Köln hat mit Urteil vom 31.10.2012 (Az.
28 O 306/11) der Klage stattgegeben.
Zweitinstanzlich wurde auch dieses Urteil im Wesentlichen bestätigt. Die entsprechende Entscheidung des OLG Köln (Az. 6 U 205/12) datiert vom 20.12.2013. Der Berufungssenat des OLG hielt es aufgrund der in beiden
Tatsachen-Instanzen durchgeführten Beweisaufnahmen für nachgewiesen, dass die
Musikdateien über den Internetanschluss des Beklagten zum Herunterladen
verfügbar gemacht worden sind. Der Beklagte sei hinsichtlich der
Urheberrechtsverletzungen als Täter anzusehen.
Das Ergebnis:
Der BGH hat
für viele überraschend alle drei Revisionen der Beklagten zurückgewiesen.
So gehen
nach der soeben veröffentlichten Pressemitteilung des BGH
die Richter des 1. Zivilsenats davon aus, dass die Eintragung der Klägerinnen
in die Phononet-Datenbank ein erhebliches Indiz für die klägerische
Rechteinhaberschaft darstellt. Es seien auch keine Anhaltspunkte zur
Entkräftung dieser Indizwirkung vorgetragen worden.
Die
theoretische Möglichkeit, dass bei Ermittlungen von proMedia oder des
Internetserviceproviders Fehler vorkommen können, spräche nicht gegen die
Beweiskraft der Ermittlungsergebnisse, wenn im Einzelfall keine konkreten
Fehler dargelegt werden. Ein falscher Buchstabe bei der Namenswiedergabe in
einer Auskunftstabelle - wie im dritten oben angesprochenen Verfahren (I ZR 19/14) - reiche insoweit nicht aus.
In dem
Rechtsstreit I ZR 75/14, dem ersten der drei oben erläuterten Verfahren, sei das Vorbringen des Beklagten, er und seine Familie
seien im Urlaub auf Mallorca gewesen und hätten vor Urlaubsantritt insbesondere
Router und Computer vom Stromnetz getrennt, durch die Vernehmung der beiden
Söhne des Beklagten und seiner Ehefrau nicht bewiesen worden. Der BGH bejaht
sogar eine täterschaftliche Haftung des Beklagten. Dieser habe nicht
dargelegt, dass andere Personen zum Tatzeitpunkt selbständigen Zugang zu seinem
Internetanschluss hatten und deshalb als Täter der geltend gemachten
Rechtsverletzungen in Betracht kommen. Somit greife die tatsächliche
Vermutung der Täterschaft des Inhabers des Internetanschlusses ein.
In dem
zweiten oben erwähnten Verfahren mit dem Aktenzeichen I ZR 7/14 habe das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass
die Tochter der Beklagten die Verletzungshandlung begangen hat. Das OLG habe
sich rechtsfehlerfrei auf das im polizeilichen Vernehmungsprotokoll
dokumentierte Geständnis der Tochter und dessen zeugenschaftliche Bestätigung
vor dem Landgericht gestützt. Die Beklagte hafte für den durch die
Verletzungshandlung ihrer damals minderjährigen Tochter verursachten Schaden
gemäß § 832 Abs. 1 Satz 1 BGB. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des BGH:
"Zwar
genügen Eltern ihrer Aufsichtspflicht über ein normal entwickeltes Kind, das
ihre grundlegenden Gebote und Verbote befolgt, regelmäßig bereits dadurch, dass
sie das Kind über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an Internettauschbörsen
belehren und ihm eine Teilnahme daran verbieten. Eine Verpflichtung der Eltern,
die Nutzung des Internets durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes
zu überprüfen oder dem Kind den Zugang zum Internet (teilweise) zu versperren,
besteht grundsätzlich nicht. Zu derartigen Maßnahmen sind Eltern erst dann
verpflichtet, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kind dem
Verbot zuwiderhandelt (BGH, Urteil vom 15. November 2012 - I ZR
74/12, GRUR 2013, 511 Rn. 24 - Morpheus). Das Berufungsgericht hat im
Streitfall jedoch nicht feststellen können, dass die Beklagte ihre Tochter
entsprechend belehrt hat. Der Umstand, dass die Beklagte für ihre Kinder
allgemeine Regeln zu einem "ordentlichen Verhalten" aufgestellt haben
mag, reicht insoweit nicht aus."
Schließlich
bestätigt der BGH bei der Bemessung des Schadensersatzes in Form der
Lizenzanalogie einen Betrag in Höhe von 200 Euro pro Musiktitel sowie
ferner den ausgeurteilten Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten auf der Basis
des RVG.
Die genauen
Entscheidungsgründe bleiben zunächst abzuwarten. In jedem Fall wurde diese
BGH-Entscheidung so von vielen - auch von mir - nicht erwartet. Andererseits
wird das Urteil des 1. Zivilsenats auch kein Grund zur Panik sein, gelten die
höchstrichterlichen Grundsätze zur Beweislast der Abmahner und zur lediglich sekundären
Darlegungslast der Abgemahnten doch auch weiterhin.
Festzuhalten bleibt schon jetzt:
- Kinder sorgfältig und nachweisbar über die Rechtswidrigkeit illegalen Filesharings belehren.
Welche sachverhaltlichen
Nuancen bei den oben dargestellten drei Revisionsfällen jeweils die entscheidende Rolle
spielten, wird sorgfältiger Analyse bedürfen.