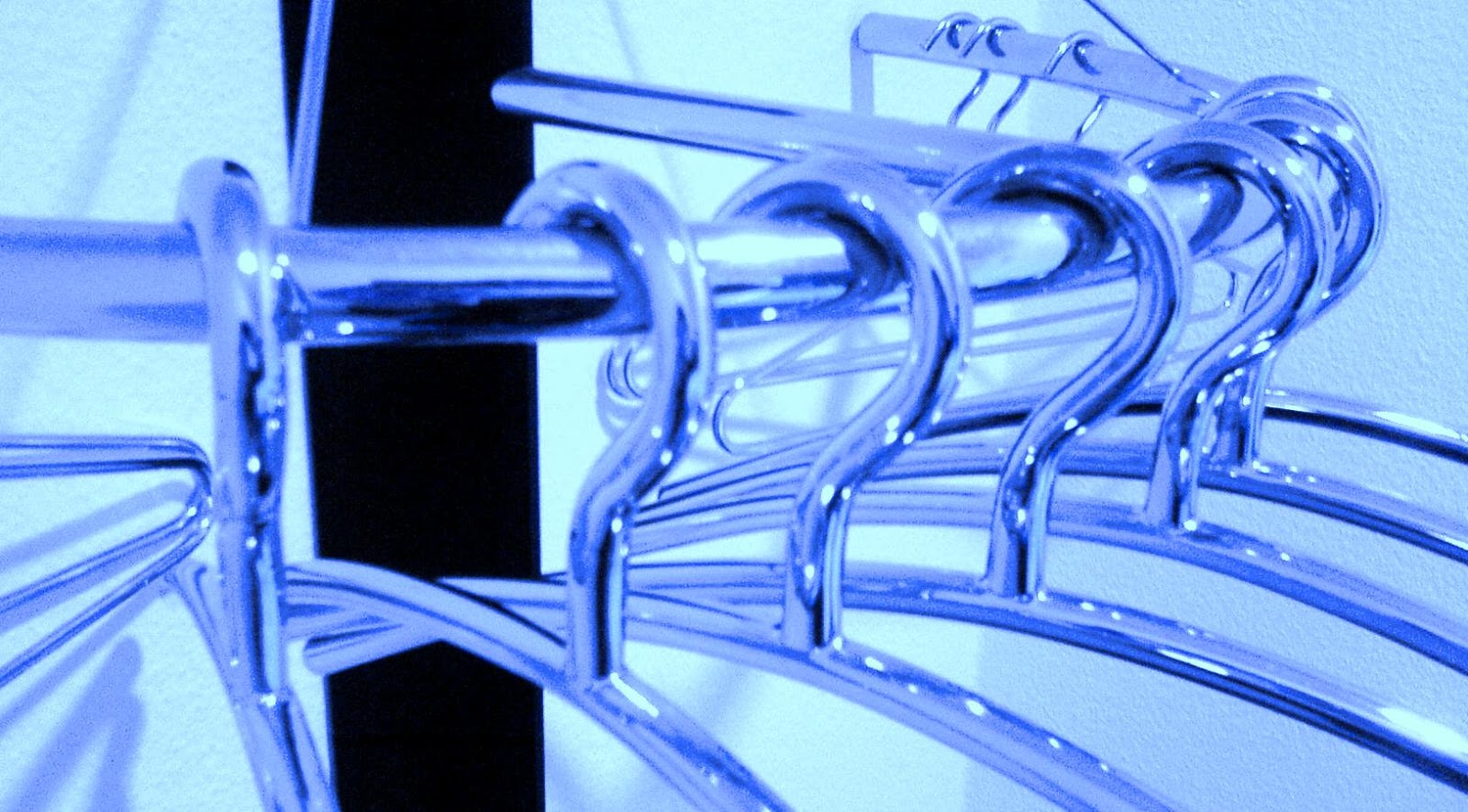Mit Update vom 08. Januar 2014
In Sachen "Filesharing-Abmahnungen" und "Störerhaftung" wird es am Mittwoch, den 08.01.2014, spannend vor dem Ersten Zivilsenat des BGH in Karlsruhe: Termin zur mündlichen Verhandlung im BearShare-Fall (Az. I ZR 169/12).
Klage erhoben hatten die vier führenden deutschen Tonträgerhersteller, anwaltlich rasch vertreten durch eine führende Hamburger Abmahnkanzlei. Beklagter ist sinniger Weise ein auf Onlinerecherchen und Internetpiraterie spezialisierter Kriminalbeamter als Inhaber eines familiären Internetanschlusses, der auch von seiner Ehefrau und dessen damals 20-jährigem Sohn genutzt wird.
Mit anwaltlicher Filesharing-Abmahnung vom 30.01.2007 warfen die vier Musiklabels dem Beklagten vor, über seinen häuslichen Internetanschluss seien im Juni 2006 über 3.700 Musikaufnahmen, in einer Online-Tauschbörse zum Download angeboten bzw. verfügbar gemacht worden, obwohl allein die Klägerinnen an dem Musikmaterial die ausschließlichen Nutzungsrechte hätten. Der Beklagte gab ohne Rechtsanerkenntnis, aber mit rechtlicher Verbindlichkeit, eine modifizierte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, lehnte allerdings eine Begleichung der geltend gemachten Schadensersatzansprüche und der Abmahnkosten ab.
Auf Antrag der Klägerinnen vom 30.12.2009 hat das Amtsgericht Hamburg gegen den Beklagten am 05.01.2010 wegen „Schadenersatz aus Unfall/Vorfall gem. Rechtsanwaltshonorar – 06-32862 KS vom 12.06.06 bis 30.01.07“ einen Mahnbescheid über 5.925,60 Euro (nebst Zinsen) erlassen, der dem Beklagten am 12.01.2010 zugestellt worden war. Nach Widerspruchseinlegung durch den Beklagten hatten die Klägerinnen in ihrer Anspruchsbegründung vom 31.03.2010 zunächst, gestützt auf 200 im Einzelnen benannte und jeweils einer der Klägerinnen zugeordnete Musiktitel, Schadensersatz i. H. v. 2.471,00 Euro sowie die Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Höhe von 3.454,60 Euro verlangt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Köln haben sie die Klage dann auf den Ausgleich der anwaltlichen Abmahnkosten beschränkt. Diese sind ihnen mit Urteil des Landgerichts vom 24.11.2010 über 3.454,60 Euro zugesprochen worden.
Der streitbare Polizist, fühlt sich für die vermeintlichen Rechtsverletzungen nicht verantwortlich. Sein volljähriger Stiefsohn habe die Musikdateien über den Internetanschluss öffentlich zugänglich gemacht. Der Stiefsohn hatte bei der polizeilichen Vernehmung zugegeben, dass er mit einem Filesharing-Programm ("BearShare") Musik auf seinen Computer heruntergeladen hat.
Das OLG Köln verurteilte den Beklagten nach seiner Berufung dennoch - unter Abweisung der Klage im Übrigen - dazu, an die Klägerinnen (nach entsprechender Streitwert-Reduzierung) zu gleichen Teilen 2.841 Euro zu zahlen und ließ gegen das Berufungsurteil keine Revision zu. Auch die Anhörungsrüge des Beklagten, mit der er seinen Antrag auf Zulassung der Revision wiederholte, fand vor dem Oberlandesgericht keine "Gnade".
Der Beklagte legte deshalb Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, das daraufhin das Berufungsurteil aufhob und die Sache an das OLG Köln zurückverwies wegen Verletzung des grundgesetzlich geschützten Rechtes des Beklagten auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Die Nichtzulassung der Revision sei von den Kölner Berufungsrichtern nicht nachvollziehbar - nämlich gar nicht - begründet worden, obwohl die Zulassung der Revision eigentlich offensichtlich nahegelegen hätte.
Das Oberlandesgericht hat daraufhin den beklagten Polizeibeamten erneut zur Zahlung von 2.841 Euro verurteilt. Der Beklagte sei für die streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzungen verantwortlich. Er habe dadurch, dass er seinem volljährigen Stiefsohn den Internetanschluss zur Verfügung gestellt habe, die Gefahr geschaffen, dass dieser illegales Filesharing betreibe. Deshalb sei es ihm zumutbar gewesen, seinen Stiefsohn auch ohne konkrete Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder bevorstehende Urheberrechtsverletzung über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an Tauschbörsen aufzuklären und ihm die rechtswidrige Nutzung entsprechender Programme zu verbieten. Die Volljährigkeit seines Stiefsohnes ändere daran nichts. Der Beklagte habe seine Stiefsohn pflichtwidrig nicht - jedenfalls nicht hinreichend - belehrt.
Das OLG Köln hat dann diesmal die Revision zugelassen, sodass nach vom Beklagten eingelegter Revision nun der in Filesharing-Streitsachen bereits mehrfach befasste Erste Zivilsenat des BGH "dran ist".
Zu klären ist insbesondere die Frage, wie weit die Haftung eines Internetanschlussinhabers bei familiärem Internetanschluss geht, ob und inwieweit etwaige anlasslose Belehrungs-, Aufklärungs-, Instruktions- und/oder Untersagungspflichten gegenüber volljährigen Familienangehörigen bestehen.
Das OLG hatte die lebensalltägliche Situation, dass "der Beklagte seinen Internetanschluss seinem zwanzigjährigen Stiefsohn zur ungestörten Nutzung auf einem in dessen Zimmer stehenden Computer zur Verfügung gestellt hat (Fettdruck durch den Autor)", zum Anlass genommen, wegen unzureichender Instruktion des Zwanzigjährigen eine Störerhaftung des Familien(Stief)vaters für Filesharing-Aktivitäten des "ungestörten" Familienmitgliedes zu bejahen. Das schreit m. E. nach der Korrektur vielleicht "gestörter" Wahrnehmung oder Bewertung familiärer Lebensrealitäten.
Update vom 08. Januar 2014:
Heute hat der
Bundesgerichtshof die erhoffte und erwartete Korrektur vorgenommen und lt.
Pressemitteilung des Ersten Zivilsenates
"entschieden, dass der Inhaber eines Internetanschlusses für das Verhalten eines volljährigen Familienangehörigen nicht haftet, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass dieser den Internetanschluss für illegales Filesharing missbraucht."
Der BGH hat das Berufungsurteil des OLG Köln aufgehoben und die Filesharing-Klage insgesamt abgewiesen. Bei der Überlassung eines Internetanschlusses an volljährige Familienangehörige sei zu berücksichtigen, dass die Überlassung durch den Anschlussinhaber auf familiärer Verbundenheit beruht und Volljährige für ihre Handlungen selbst verantwortlich sind. Es bestehe ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Familienangehörigen. Deshalb und wegen der Eigenverantwortung von Volljährigen dürfe der Anschlussinhaber einem volljährigen Familienangehörigen seinen Internetanschluss überlassen, ohne das insoweit Belehrungspflichten oder gar Überwachungspflichten bestehen. Erst wenn der Anschlussinhaber - z. B. aufgrund einer Abmahnung - konkreten Anlass für die Befürchtung hat, dass der volljährige Familienangehörige den Internetanschluss für Rechtsverletzungen missbraucht, hat er die zur Verhinderung von Rechtsverletzungen erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Da derartige Anhaltspunkte hier nicht vorlagen, verneinten die Karlsruher Richter eine Störerhaftung.
Also gab es auch keine Unterlassungsansprüche und damit auch keine Ansprüche auf Erstattung anwaltlicher Abmahnungskosten. Sobald das vollständige Urteil mit schriftlichen Entscheidungsgründen vorliegt, werden weitere Bewertungen über die Konsequenzen für zukünftige bzw. noch nicht rechtskräftig gerichtlich behandelte Filesharing-Abmahnungen erfolgen können. In jedem Fall hat diese höchstrichterliche Entscheidung die Position des Geschäftsmodells "Filesharing-Abmahnung" erheblich geschwächt und die Verteidigungsmöglichkeiten gegen unberechtigte Abmahnungen entscheidend verbessert.