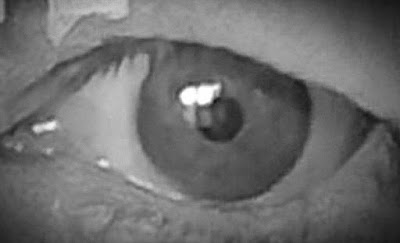Obwohl von Rechtsanwälten eigentlich fundierte rechtliche Hilfe benötigt und zu Recht erwartet wird, kommen immer wieder schlimme Enttäuschungen und tatsächlich schamlose Zumutungen vor … zum Leidwesen so mancher Mandanten.
Dr. jur. Ralf Petring war fast 40 Jahre lang als Medienanwalt aktiv und hatte Einblick in die erschreckenden Praktiken mancher Juristen, die als schwarze Schafe den Berufsstand der Anwälte in Misskredit bringen.
Doch was sind die hauptsächlichen Unsitten bei anwaltlichen Dienstleistungen?
Nr. 1
Es beginnt bereits vor der eigentlichen rechtlichen Beratung oder Vertretung, nämlich bei marktschreierischer unzutreffender Außendarstellung, unlauterer, irreführender Werbung. Da werden nicht selten Kompetenzen vorgegeben, die so nicht bestehen.
Es ist viel anständiger und für die Rechtssuchenden hilfreicher, wenn ihnen der zunächst angesprochene Anwalt stattdessen tatsächlich auf dem relevanten Rechtsgebiet spezialisierte Kanzleien empfiehlt – oder zumindest Stellen oder Quellen nennt, über die fachlich einschlägig ausgewiesene Juristen auffindbar sind.
Nr. 2
Eine fehlende oder unzureichende Aufklärung über bestehende Risiken – materiellrechtlicher, verfahrensrechtlicher und kostenmäßige Art – kann zu späterem bösen Erwachen führen. Der Anwalt ist aber verpflichtet, auf Prozessrisiken und Kostenrisiken unmissverständlich hinzuweisen.
Nr. 3
Stattdessen wird das Mandat manchmal nach der Kanzlei bzw. dem Kanzleiumsatz zugute kommenden Gesichtspunkten ausgeführt. Das kann z. B. dadurch geschehen, dass die konkreten anwaltlichen Tätigkeiten vorrangig danach ausgerichtet werden, Streitgegenstände mit hohen Streitwerten zu priorisieren und auch ggf. im konkreten Fall eigentlich unnötige Gebührentatbestände auszulösen. Letzteres kann u. a. etwa durch eine vermeidbare Instanz, eine verzichtbare Besprechung(sgebühr) oder einen unangebrachten Vergleich (mit daraus ableitbarer Einigungsgebühr) entstehen. Wobei ein Abraten von verfahrensverkürzenden und Kostenrisiken begrenzenden Kompromissen sich ebenfalls als Kostenschneiderei und unnütze „Instanzen-Turnerei“ darstellen kann.
Nr. 4
Eigentlich selbstverständlich, allerdings häufig vernachlässigt wird die zunächst regelmäßig erforderliche exakte Klärung der den Rechtsfragen bzw. dem juristischen Streit zugrundeliegenden Sachverhalte. Ohne ausreichenden anwaltlichen Zeiteinsatz bei der Ermittlung, Erörterung und evtl. möglichen Prüfung der entscheidungserheblichen tatsächlichen Vorgänge kann eine belastbare rechtliche Bewertung nicht erfolgen.
Nr. 5
Übersehen oder übergangen wird anschließend gerne die Frage der sogenannten Beweislast. Welcher der Streitparteien ist im etwaig anstehenden Prozess denn verpflichtet, entscheidungsrelevante Tatsachen nachzuweisen? Und welche wie zu bewertenden Beweismittel (etwa Zeugen, Urkunden bzw. Verträge) stehen der eigenen Seite oder der Gegenseite zur Verfügung? Das sollte frühzeitig geklärt und abgewogen werden.
Nr. 6
Die sechste Todsünde so mancher Rechtsanwälte betrifft ein Hauptfeld ihrer Profession: Das zielführende Argumentieren gegenüber der Gegenseite, dem Gegenanwalt, dem Gericht oder der Behörde. Es kann entscheidend sein, ob, wann und auf welche Weise mein Anwalt welche Argumente anbringt, ob er schlagkräftige Einwendungen übersieht oder auslässt, ob der Rechtsvertreter sein Pulver evtl. zu früh verschießt, die Gegenseite unterschätzt – oder sogar fälschlicherweise überschätzt und ob er in der mündlichen Gerichtsverhandlung durch ein engagiertes und überzeugendes Plädoyer das Ruder vielleicht noch herumreißen kann.
Nr. 7
Nicht nur, aber auch bei Anwälten kommt es vor: arrogantes, herablassendes, unfreundliches Auftreten – und zwar gegenüber der Mandantschaft, der Gegenseite, den Gegenanwälten, dem Gericht und/oder der Behörde. Das erschwert oder verhindert sogar angemessene Lösungen und ein konstruktives Verhandlungsklima sowie die Bereitschaft aller Beteiligten, daran mitzuwirken. Stattdessen Öl ins Feuer zu gießen dient allenfalls anwaltlichen Honorarambitionen.
Der interessengerecht agierende Rechtsanwalt bleibt sachlich und besonnen. Und er (oder sie!) kommuniziert proaktiv, wobei durchgängig und transparent der Kontakt mit der Mandantschaft gehalten wird – zum jeweils aktuellen Stand der Dinge und über anstehende Verfahrensabläufe.
Zum Thema auch mein gleichlautender YouTube-Beitrag vom 08.03.2025.